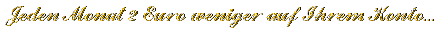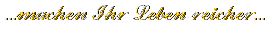Ein Junge, der eine Pistole auf uns
richtet: So hat die «Weltwoche» ein Foto für eine Anti-Roma-Kampagne
instrumentalisiert. Die WOZ hat den Jungen, Mentor M., und seine Familie
vor Ort im Kosovo besucht und zeigt, wer und was hinter dem Bild
steckt. Eine Reportage über die wahre Situation der Roma und die
schamlose Manipulation der «Weltwoche».
Vor
einer Woche ist er mir das erste Mal begegnet: ein kleiner Junge,
dunkle Haut, dunkle Augen, dunkle Haare – in der Linken hielt er eine
Spielzeugpistole und zielte auf mich, auf uns, auf jeden, der in der
Schweiz an einem Kiosk vorbeiging. Sein Blick: War er ernst? Traurig?
Bedrohlich? Der Junge zielte nicht auf uns. Die Zeitschrift, die das
Foto veröffentlichte, zielte auf ihn – und auf seine Gemeinschaft. Unter
dem Bild titelte sie: «Die Roma kommen: Raubzüge in die Schweiz».
Jetzt schaut Mentor M. etwas ratlos in die Runde: der Haarwirbel über
dem rechten Auge, die fallenden Augenwinkel, der leichte
Silberblick – er ist ohne Zweifel der Junge vom «Weltwoche»-Titelbild.
Es ist Freitagnachmittag, der 13. April, kurz nach vier Uhr, als wir
das kleine Haus von Mentors Familie betreten. Vater Rexhep und Mutter
Teuta begrüssen uns herzlich, Mentor und seine Schwestern Sinita und
Shkurte setzen sich schüchtern neben ihre Eltern. Wir hocken in einem
knapp zwölf Quadratmeter grossen Raum im Roma-Ghetto vor Gjakova im
Westen Kosovos. Die Wände sind rosafarben gestrichen, ein Herd steht in
der Ecke, im Hintergrund läuft ein kleiner Fernseher, ein alter
Computerbildschirm flimmert. Als wir dem Vater die Zeitschrift geben,
schlägt er die Hände vors Gesicht, im Bewusstsein, dass eine Kamera auf
ihn gerichtet ist, und sagt dann: «Ich bin schockiert. Mein Sohn auf
dieser Zeitschrift – jeder kann ihn so sehen, mit einer Pistole in der
Hand. Die Leute werden denken, wir seien Kriminelle, Diebe.» Rexhep
zeigt Mentor das Heft: Er sieht uns fragend an, unsicher, verschämt
vielleicht und schüttelt dann den Kopf. Am nächsten Tag wird mir seine
Tante Shyhrete erzählen, dass Mentor deswegen in der Nacht geweint habe.
«Wir sind keine Verbrecher», sagt Rexhep. Mentors jüngere Schwester
Sinita lutscht an einem Plastikstängel, den sie zuvor in ein Tütchen mit
Zucker gesteckt hat. Rexhep zeigt mit der Hand in den mit Teppichen
ausgelegten Raum, der der fünfköpfigen Familie als Wohn- und
Schlafzimmer dient: «Wir sind ehrliche, einfache Leute. Sie sehen ja,
wie wir hier leben: Wir haben kaum zu essen, keine Arbeit, nichts …»
Am Ende der Siedlung
Der Italiener Livio Mancini hatte 2008 als eingebetteter Fotograf der
KFOR-Truppen die Roma-Siedlung vor Gjakova besucht. Er fotografierte
Mentor mit einer Spielzeugpistole. Ein Sujet, das nach Kriegen in allen
Ländern leicht zu finden ist. Auch wir begegnen während unserem
zweitägigen Aufenthalt in der Siedlung einem Jungen, der ein
Spielzeuggewehr auf uns richtet. Die «Weltwoche» verwendete Mancinis
Bild als Illustration für einen Artikel über kriminelle Roma in der
Schweiz. Nur: Weder der abgelichtete Mentor (der laut Autor Philipp Gut
als Symbol dafür stehe, «dass Roma-Banden ihre Kinder für kriminelle
Zwecke missbrauchen») noch dessen Familie haben den Kosovo je verlassen.
Als Mancini das Foto schoss, war Mentor gerademal vier Jahre alt. Am 9.
März dieses Jahres feierte er seinen achten Geburtstag. An den Tag, an
dem er mit der Spielzeugpistole in der Hand fotografiert wurde, erinnert
er sich nicht mehr. Er war zu jung damals.
Anfang letzter Woche fand die WOZ heraus, dass der Slum vor Gjakova
teilweise noch immer existiert, aber die Roma unter anderem vom
Schweizer Hilfswerk Caritas, der Gemeinde Gjakova, der Regierung des
Kosovo und anderen Hilfswerken unterstützt werden: Die rund 800 Roma in
der «Kolonie», wie die BewohnerInnen die illegale Siedlung nennen,
sollen in neue Häuser umziehen, auf eine Landparzelle in unmittelbarer
Nähe, die die Stadt zur Verfügung gestellt hat. Insgesamt 120 Häuser
sollen in drei Phasen gebaut werden: Die ersten 29 Häuser stehen schon,
die nächste Bauetappe soll demnächst beginnen und bis im Herbst
abgeschlossen sein.
Der Fotograf Fabian Biasio und ich entschieden, in den Kosovo zu
fahren, um den Jungen zu suchen, und baten Caritas um Hilfe. Am Tag vor
unserer Abreise in den Kosovo teilte mir die lokale
Caritas-Mitarbeiterin am Telefon mit, ein Kollege habe die Familie
gefunden. Sie sei bereit, uns zu empfangen.
Erste Tropfen fallen, als wir kurz vor Gjakova sind. Am Strassenrand
steht ein altes Postauto mit eingeschlagenen Scheiben. Eine Abzweigung
führt uns nach «Ali Ibra», so nennt die Caritas die neue Siedlung, die
derzeit gebaut wird. Die geteerte Strasse ist hier zu Ende. Petflaschen,
Plastiksäcke, Papierschnipsel säumen den schmalen Streifen Schlamm, der
uns in die Kolonie bringt.
Der achtjährige Mentor lebt mit seiner Familie am Ende der Siedlung,
dahinter liegt eine grosse Wiese, ein ehemaliges Tabakfeld, und alle
paar Meter: nasse Kartons, zerrissene Säcke, rostende Büchsen. Gleich
neben dem Haus befindet sich das Mülldepot K-Ambienti, wo Papier,
Petflaschen und Plastik sortiert, gepresst und gebündelt werden. Mentor
arbeitet nicht dort. Hat er nie. Früher hätten die Kinder jeweils bei
der alten Deponie am anderen Ende der Siedlung gespielt, sagt Rexhep,
der dreissigjährige Vater von Mentor. Aber seit einem Jahr besucht
Mentor eine öffentliche Schule in Gjakova, keine zwanzig Minuten von der
Kolonie entfernt. Zuvor hat er den Kindergarten der Caritas in Ali Ibra
besucht.
Mentors 9-jährige Schwester Shkurte schneidet Scherenschnitte und
gibt ihrem Bruder die restlichen Schnipsel, die er bemalt. Mentor geht
gern zur Schule, sagt er. Sein Lieblingsfach sei Zeichnen. Aber wenn es
nach dem Vater geht, soll Mentor diese Woche zu Hause bleiben. Rexhep
sagt, er befürchte, dass Mentor gehänselt und als Krimineller beschimpft
werde. «Über das Internet kann jeder das Bild sehen und den Titel
übersetzen.» In der Siedlung haben einige das Bild gesehen. Sie wundern
sich auch darüber, was die ausländischen Journalisten bei der Familie
tun. Die ganze Geschichte macht Rexhep wütend. Er sagt, er wolle Klage
gegen die Verantwortlichen einreichen, die das Bild missbraucht hätten.
Dafür benötigt er die Hilfe der Caritas, alleine wird er das kaum machen
können. Allein schon des Geldes wegen.
Auf Arbeitssuche
Rexhep erhält monatlich 75 Euro Sozialhilfe vom Staat, allerdings nur
noch zwei Monate lang. Danach ist Schluss. Seine jüngste Tochter ist
eben sechs geworden, und der Staat zahlt nur für Kinder bis fünf Jahre.
Jeden Tag fährt Rexhep frühmorgens in die Stadt und sucht Arbeit. Er hat
einen Kredit aufgenommen für ein kleines, offenes Gefährt, auf das
hinten eine Kreissäge montiert ist. Damit fährt er ins Zentrum und
wartet, bis er einen Auftrag erhält. Oder er hilft einem Kollegen, wenn
gerade Arbeit anfällt. So läppert sich immer wieder ein wenig Geld
zusammen. Mal verdiene er drei Euro am Tag, mal fünf, sagt Rexhep. Ein
Arbeitskollege von Rexhep, den ich später in der Stadt treffe, erzählt
mir, dass es manchmal auch mehr sei: Zehn, fünfzehn Euro könnten es an
einem guten Tag sein – ein durchschnittlicher Monatslohn in Kosovo
beträgt 200 Euro. Allerdings, sagt der Kollege, hätten sie meistens nur
etwa zwei Tage die Woche Arbeit.
Und trotzdem: Als ich Mentor frage, was er später arbeiten möchte,
zögert er erst, zeigt dann auf Rexhep und sagt: «Ich will mit Holz
arbeiten, wie mein Vater.» Am nächsten Tag, als wir durch die
Roma-Siedlung spazieren und seine Verwandten besuchen, scheint Mentor
Gefallen an meinem Notizblock gefunden zu haben. Seine Pläne haben sich
geändert. Er sagt, er wolle «Gazetar» werden – Journalist.
Die ganze Reportage lesen Sie am Donnerstag, 19. April, in der WOZ.
[Quelle: http://www.woz.ch/-29b6]