 |
|
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Staatsterror durch staatliche Eingriffe in das Familienleben
Verletzung von Menschenrechten, Kinderrechten, Bürgerrechten durch Entscheiden und Handeln staatlicher Behörden im familienrechtlichen Bereich, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienhilfe unter anderem mit den Spezialgebieten Jugendamtsversagen und Jugendamtsterror
Fokus auf die innerdeutsche Situation, sowie auf Erfahrungen und Beobachtungen in Fällen internationaler Kindesentführung und grenzüberschreitender Sorgerechts- und Umgangsrechtskonflikten
Fokus auf andere Länder, andere Sitten, andere Situtationen
Fokus auf internationale Vergleiche bei Kompetenzen und Funktionalitäten von juristischen, sozialen und administrativen Behörden
"Spurensuche
nach Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen"
ist ein in assoziiertes Projekt zur
angewandten Feldforschung mit teilnehmender Beobachtung
"Systemkritik: Deutsche
Justizverbrechen"
http://www.systemkritik.de/
|
|
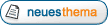 |
 |
|
Anfang
zurück
weiter
Ende
|
| Autor |
Beitrag |
Gast
|
 Erstellt: 18.09.07, 13:50 Betreff: Vorbereitung auf einen begleiteten Umgang
drucken
weiterempfehlen Erstellt: 18.09.07, 13:50 Betreff: Vorbereitung auf einen begleiteten Umgang
drucken
weiterempfehlen
|
 |
|
Vergho: Die Vorbereitung auf einen begleiteten Umgang - Ein Praxismodell unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs im Kontext familiärer Gewalt FPR 2007 Heft 7-8 296 - 301
Die Vorbereitung auf einen begleiteten Umgang - Ein Praxismodell unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs im Kontext familiärer Gewalt*
Diplom-Psychologe Claudius Vergho, Regensburg
Die Literatur zum begleiteten Umgang beschäftigt sich vorrangig mit dessen grundsätzlichen Chancen und Risiken, Möglichkeiten und Grenzen. Im folgenden Artikel soll auf einen weiteren wichtigen Aspekt des begleiteten Umgangs näher eingegangen werden: dessen gründliche Vorbereitung. Sie beinhaltet zum einen die fachliche Überprüfung der gerichtlich-initiierten Maßnahme im Hinblick auf das Kindeswohl, seine Realisierbarkeit und Erfolgsaussichten. Zum anderen werden dabei auch Eltern und Kinder auf den Umgang eingestimmt. Gerade beim Eltern-Kind-Kontakt im Kontext familiärer Gewalt ist eine gründliche Vorbereitung unerlässlich. Dabei wird versucht, durch ein Gewalt-Screening und eine darauf basierende Sicherheitsplanung den Schutzbedürfnissen der Opfer gerecht zu werden. Der Autor hat zusammen mit seinen Kollegen und Kolleginnen 15 Jahre Erfahrung mit ca. 120 Fällen von gerichtlich-initiierten begleiteten Umgängen gesammelt. Die folgenden Ausführungen sind Gedanken, Erfahrungen und Reflexionen eines Praktikers für die interessierte Fachöffentlichkeit. Zum vereinfachten Verständnis wird im folgenden Text von der Umgangsbegleitung des Vaters mit seinem Kind ausgegangen.
I. Regensburger Praxis des Zusammenwirkens von Familie, Familiengericht und Beratungsstelle beim begleiteten Umgang1
Die „Familienberatung bei Trennung und Scheidung am AG Regensburg“ bietet seit 1991 in Trägerschaft des Diakonischen Werkes betroffenen Familien vor, während und nach einer Trennung/Scheidung Beratung, Vermittlung und (therapeutische) Unterstützung an. Diese gerichtsnahe Einrichtung zeichnet sich vor allem aus durch die
-
räumliche Integration der Beratung in das Gerichtsgebäude,
-
Überweisungen von Ratsuchenden, die sich im gerichtlichen Verfahren befinden, durch Richterinnen und Anwälte (gerichtsnaher Zugang),
-
Kooperationsformen und interdisziplinären Arbeitsabläufe, die Beratung und Vermittlung einerseits und familiengerichtliches Verfahren andererseits aufeinander abstimmen. Dabei sind Familienrichter und Berater gleichwertige Partner mit klarer Aufgaben- und Kompetenztrennung.
Ein Aufgabenbereich ist die Kontaktanbahnung bzw. der begleitete Umgang, der sowohl von den Eltern selbst, vom Jugendamt oder meist vom Familiengericht initiiert bzw. beschlossen werden kann.
Grundsätzlich unterliegt die Arbeit der Beratungsstelle der Schweigeverpflichtung. Eine Ausnahme stellt dabei ein vom Gericht verfügter begleiteter Umgang dar. Hier sind die Mitarbeiter verpflichtet, dem Gericht Auskunft sowohl über das Zustandekommen der Maßnahme als auch über die Beobachtungen während des begleiteten Umgangs zu geben.
Im Unterschied zu anderen Kooperationsmodellen von Justiz und Beratung zeichnet sich das Regensburger Procedere unter anderem folgendermaßen aus:
-
Die Beratungsstelle übernimmt nicht automatisch den Beschluss bzw. die elterliche Vereinbarung eines begleiteten Umgangs, sondern überprüft in fachpsychologischer Eigenständigkeit diese Maßnahme im Hinblick auf das Kindeswohl, die Realisierbarkeit und die Erfolgsaussichten. Somit besteht die Möglichkeit, einen begleiteten Umgang nach der Vorbereitung bzw. einer Erprobungsphase auszuschließen bzw. abzubrechen.
-
Kommt es zum Ausschluss, Abbruch oder einer sonstigen massiven Störung des begleiteten Umgangs erhält das Familiengericht eine „qualifizierte Sachstandsmitteilung“ mit fachpsychologischer Begründung und eventuell Vorschlägen zum weiteren Vorgehen. Somit hat die Beratungsstelle neben der „juristischen Hoheit“ des Gerichts eine eigenständige „fachliche Hoheit“ über das Zustandekommen bzw. die Ausgestaltung eines begleiteten Umgangs.
-
Die Beratungsstelle legt großen Wert auf eine gründliche Vorbereitung des begleiteten Umgangs mit allen Beteiligten.
-
Die einschlägigen Gerichtsbeschlüsse bzw. elterlichen Vereinbarungen vor Gericht sind möglichst „niedergeregelt“ formuliert, um dem Mitarbeiter der Beratungsstelle fachlichen Spielraum bei der Durchführung und Ausgestaltung des begleiteten Umgangs zu ermöglichen.
-
Für die Beratungsstelle besteht absolute Schweigepflicht bei einem begleiteten Umgang nach einer elterlichen Vereinbarung vor Gericht. Es besteht gleichermaßen eine Aussageverpflichtung der Beratungsstelle dem Gericht gegenüber bei einem gerichtlich angeordneten begleiteten Umgang sowohl über dessen Zustandekommen als auch über die Beobachtungen während des begleiteten Umgangs.
-
Der Umgangsbegleiter kann an Familiengerichtssitzungen teilnehmen, um erste Absprachen zum Zeitplan des begleiteten Umgangs zu treffen.
-
Es besteht eine finanzielle Unabhängigkeit der Beratungsstelle vom Gericht, da der begleitete Umgang nicht fallbezogen abgerechnet wird und die Beratungsstelle somit kein finanzielles Interesse am Zustandekommen oder an der Dauer der Maßnahme hat.
-
Für die betroffenen Eltern gibt es in der Regel keine schriftlichen vertraglichen Vereinbarungen zur Ausgestaltung bzw. zu den Bedingungen des begleiteten Umgangs, ebenso keine Verpflichtung zur Teilnahme an „flankierenden Umgangsberatungen“ mit beiden Eltern, Elterngruppen oder „Täter-Gruppen“ bei Gewalthandlungen.
II. Begleiteter Umgang - ein verfänglicher Begriff?
Die Vorbereitung auf einen begleiteten Umgang beginnt mit der Formulierung des Beschlusses bzw. der elterlichen Vereinbarung vor Gericht.
In der Fachliteratur, Rechtsprechung und Beratungspraxis gibt es häufig unterschiedliche Begrifflichkeiten: Die Rede ist vom „begleiteten“, „überwachten“, „geschützten“, „unterstützten“, „kontrollierten“ Umgang. All diese Adjektive beschreiben etwas unterschiedliche Funktionen des begleiteten Umgangs. Einige davon implizieren eine „Täter-Opfer-Beziehung“ zwischen einem Vater und seinem schutzbedürftigen Kind. Der Hintergrund für die gerichtliche Anordnung bzw. Anregung ist aber nicht immer der Schutz des Kindes vor seinem Vater. Häufig verfügen Richter bei einem hocheskalierten Elternkonflikt einen begleiteten Umgang, obwohl der Vater in der familiären Vergangenheit eine gute und enge Beziehung oder zumindest einen unproblematischen Kontakt zu seinem Kind hatte.
Viele der oben genannten Begriffe stoßen deshalb vor allem bei Vätern verständlicherweise schnell auf Abwehr und Widerstand, weil sie sich damit quasi als Täter präjudiziert fühlen. Sicherlich hat der begleitete Umgang auch eine Schutzfunktion zum Wohle des Kindes, so dass entsprechende Begriffe auch angemessen sein können.
Auch der Begriff „Umgang“ wirkt auf viele Eltern sehr versachlichend und wenig gefühlsbetont, was häufig den väterlichen Bedürfnissen und ihrem Selbstverständnis nicht gerecht wird.
Es ist sehr schwierig, einen für beide Elternteile gleichermaßen attraktiven und einladenden Begriff zu finden. Ein Praxisvorschlag dazu: In den Vorbereitungsterminen mit Eltern (möglicherweise auch mit den Kindern) kann man die Frage des passenden Begriffs thematisieren und diskutieren und erhält interessante Informationen zu Vorstellungen, Einstellungen oder Wünschen an einen begleiteten Umgang. Gelegentlich ist es möglich, sich zumindest mit einem Elternteil auf einen passenden Begriff zu einigen, zum Beispiel den der „Spielstunde“ oder „Papa-Treff“. Solche Begriffe können den inneren Zugang von Vätern zu einem begleiteten Umgang erleichtern.
III. Hochgeregelte vs. niedergeregelte Beschlüsse zum begleiteten Umgang als Arbeitsgrundlage
Kommt es zu einer gerichtlichen Anordnung, so stellt die inhaltliche Ausformulierung des Beschlusses wichtige Weichen für das Gelingen bzw. die Arbeitsbedingungen des begleiteten Umgangs. Dabei gibt es eine grundlegende Unterscheidung zwischen so genannten „niedergeregelten“ Gerichtsbeschlüssen und „hochgeregelten“. Bei ersteren formuliert der Richter die Verpflichtung zum begleiteten Umgang und legt einen zeitlichen Rahmen fest. Die „fachlichen Ausführungsbestimmungen“ überlässt er explizit dem Umgangsbegleiter der Beratungsstelle. Dieser wird per Gerichtsbeschluss ermächtigt, entsprechende Vereinbarungen und nötige Ausdifferenzierungen zum begleiteten Umgang mit den Eltern selbst zu treffen bzw. diese festzulegen, falls es zu keiner Einigung mit den Eltern kommt. Damit hat der Umgangsbegleiter einen fachlichen Spielraum, den er zum Wohl der Kinder unter Berücksichtigung der speziellen Familien- und Lebenssituation nutzen kann.
Beispiele für niedergeregelte Beschlüsse:
„Der Antragsteller übt das begleitete Umgangsrecht in den Räumen der Familienberatung bei Trennung und Scheidung nach näherer Vereinbarung der beiden Parteien und dem zuständigen Mitarbeiter der Beratungsstelle aus …“. „Der begleitete Umgang findet möglichst wöchentlich statt, jeweils zwischen ein und zwei Stunden nach Ermessen des Umgangsbegleiters. Der Umgangsbegleiter ist berechtigt, bei Bedarf und Notwendigkeit Ersatztermine festzulegen …“
Ein Beispiel für einen hochgeregelten Beschluss:
„Der Antragsteller übt das Umgangsrecht bis auf weiteres … in den Räumen der Familienberatungsstelle des Diakonischen Werkes unter fachpsychologischer Aufsicht aus, und zwar am … von 17 bis 19 Uhr und am … von 17 bis 18.30 Uhr. In der Folgezeit übt der Antragsteller das begleitete Umgangsrecht zweimal monatlich für jeweils ca. 1½ Stunden nach näherer Vereinbarung mit der Beratungsstelle aus. Die Antragsgegnerin hat das Kind jeweils zum Beginn der festen Umgangszeiten zur Beratungsstelle zu bringen und nach Ablauf der festgesetzten Umgangszeiten von dort wieder abzuholen … Das begleitete Umgangsrecht soll erst zum … beginnen, um den Parteien und auch dem Kind genügend Zeit zu geben, sich auf den begleiteten Umgang vorzubereiten. Dabei erwartet das Gericht insbesondere auch von der Mutter, dass sie zur Vorbereitung des Umgangs die Dienste der Beratungsstelle in Anspruch nimmt. Es ist nämlich ein vordringliches Problem, dem Kind bestehende Ängste vor einem Zusammentreffen zu nehmen und es an die Umgebung der Beratungsstelle zu gewöhnen … Das Gericht erwartet daher von der Antragsgegnerin, dass sie alle förderlichen Maßnahmen für das Funktionieren des begleiteten Umgangs unternimmt, insbesondere die fachpsychologische Unterstützung der Beratungsstelle in der Zeit vor dem … . Jedes andere Verhalten der Antragsgegnerin würde die Gefahr heraufbeschwören, dass gerichtliche Zwangsmaßnahmen ergriffen, notfalls sogar das Aufenthaltsbestimmungsrecht überdacht werden müsste.“
Solche Beschlüsse sind nur nach vorheriger Absprache zwischen Richter und Umgangsbegleiter über die Zeitkapazität der Beratungsstelle möglich.
Vorbereitungstermine werden in entsprechenden Beschlüssen als unerlässlich und damit verpflichtend angesehen. Das stimmt die Eltern auch darauf ein, dass nicht unmittelbar nach der Beschlussfassung ein begleiteter Umgang unvorbereitet stattfinden kann. Meistens enthält ein Gerichtsbeschluss auch den Hinweis darauf, dass der Umgangsbegleiter verpflichtet ist, dem Gericht Auskunft über das Zustandekommen und die Beobachtungen während der Maßnahme zu geben.
IV. Vorbereitung auf einen begleiteten Umgang
1. Fachliche Überprüfung der Maßnahme im Hinblick auf Kindeswohl, Realisierbarkeit und Erfolgsaussichten durch die Beratungsstelle
Eine fachliche Überprüfung bzw. Einschätzung setzt die Existenz von Kriterien für den Ausschluss bzw. den Abbruch eines begleiteten Umgangs voraus. Dabei werden Bedingungen und Voraussetzungen festgelegt, unter denen der Versuch eines begleiteten Umgangs gerechtfertigt erscheint. Vor allem im Kontext familiärer Gewalt geht es darum, kindeswohlgefährdende Risiken auszuschalten. Eine wesentliche Bedingung für die Durchführung der Maßnahme ist das Recht des Umgangsbegleiters, auch einseitig auf Grund subjektiver Einschätzungen ein Zusammentreffen abzubrechen, ohne in der Situation dem Vater dafür eine Begründung abgeben zu müssen.
Abbruchkriterien können zum Beispiel Verstöße des Vaters gegen vorherige Vereinbarungen und somit kindschädigende Verhaltensweisen sein, auch heftige Konflikte zwischen Vater und Umgangsbegleiter während der begleiteten Umgangstermine können zum Abbruch führen, wenn dadurch das subjektive Sicherheits- und Schutzempfinden des Kindes (massiv) beeinträchtigt wird.
Grundsätzlich sind Umgangsbegleitungen für Kinder fast immer belastend, weil sie sehr häufig mit Loyalitätskonflikten verbunden sind. Noch massivere Belastungen stellen traumatische Erfahrungen des Kindes aus dem Zusammenleben mit dem Vater und damit verbundene Ängste dar. In solchen Fällen kann der Umgangsbegleiter abwägen, inwieweit eine vorausgehende Traumatherapie für das Kind hilfreich und sinnvoll ist, und eventuell eine unabdingbare Voraussetzung des begleiteten Umgangs darstellt. Bei nachgewiesenen Missbrauchserfahrungen kann die Frage einer vorausgehenden Therapie meist eindeutig beantwortet werden: Eine Zusammenführung von Vater und Kind ist nicht verantwortbar, solange das Kind sich nicht durch eine begleitende Psychotherapie des Vaters während des begleiteten Umgangs sicher und geschützt fühlen kann. Bei einer Suchtproblematik oder psychopathologischen Auffälligkeiten des Vaters muss im Einzelfall geprüft werden, inwieweit Behandlungsmaßnahmen vorgeschaltet werden müssen.
Auch die Frage der Abbruchkriterien für einen begleiteten Umgang ist schwer zu beantworten. Eine Orientierung bei der Einschätzung der Belastung und damit Zumutbarkeit eines begleiteten Umgangs für Kinder bieten die Ergebnisse der Bindungsforschung.
Hierzu liegen Einschätzungsskalen2 vor, anhand derer man zum Beispiel das „Ausmaß der Belastung des Kindes bei dem begleiteten Umgang“ einschätzen kann. So wird zum Beispiel die Belastung als gering eingestuft, wenn das Kind während des begleiteten Umgangs bezüglich Körperhaltung und Mimik weitestgehend entspannt und sicher wirkt und eine spielbezogene, ungezwungene Interaktion mit dem Vater pflegt. Als Hinweis auf eine hohe Belastung gilt dagegen, wenn zwischen Vater und Kind ein organisiertes Spiel- oder Gesprächsverhalten kaum oder nicht mehr möglich erscheint, wenn das Kind Angst und Hilflosigkeit äußert, stumm, untätig, starr wird oder zu weinen beginnt. Eine noch höhere Belastung wird vermutet, wenn das Kind zeitweise in einen Zustand unkontrollierter Erregung gerät und bizarres oder extrem clownhaftes Verhalten zeigt. Auch aggressive oder feindselige Verhaltensweisen, die sich in aktiven Handlungen oder verbalen Angriffen gegen den Vater richten, werden als Anzeichen einer hohen psychischen Belastung gewertet.
Ebenso gibt es Skalen zur Einstufung von „Unterstützung und Wertschätzung“ des Vaters dem Kind gegenüber. Auch die „elterliche Spielfeinfühligkeit“ kann eingestuft werden, ebenso das „Vermeidungsverhalten“ von Kindern ihrem Vater gegenüber. All diese Skalen stellen die Abbruchkriterien auf eine „objektivere“ Grundlage. Die Gretchen-Frage bei der Durchführung eines begleiteten Umgangs lautet aber immer wieder: Steht der Wert eines Vater-Kind-Kontaktes in einem vertretbaren Verhältnis zu den dadurch entstehenden Belastungen für das Kind (Kosten-Nutzen-Analyse des Kindeswohls).
2. „Einstimmung“ und konkrete Vorbereitung der Familienmitglieder3
In der Einstimmung bzw. Vorbereitung der beteiligten Familienmitglieder kann man vier Bereiche voneinander unterscheiden:
a) Klare Absprachen bzw. Informationen über die (äußeren) Rahmenbedingungen. Meist sind die wichtigsten zeitlichen Rahmenbedingungen für einen begleiteten Umgang gerichtlich fixiert. Darüber hinaus gibt es aber eine Menge von zusätzlichen Absprachen und Vereinbarungen, die vom Umgangsbegleiter - wenn möglich unter Einbeziehung der Eltern - festgelegt werden.
Sie betreffen zum Beispiel Absprachen zur Örtlichkeit, zur personellen Durchführung, zur An- bzw. Abwesenheit von vierten Personen während der Umgangsbegleitung, zum schrittweisen Rückzug der Mutter aus der Umgangssituation, zur Erreichbarkeit bzw. Verfügbarkeit der Mutter bei auftretenden Problemen, zur „Übergabe-Praxis“, zur Praxis von Terminabsagen bzw. Nachholterminen, zu zeitlichen Perspektiven bzw. zum „zeitlichen Fahrplan“ der Überführung des begleiteten Umgangs in einen unbegleiteten Kontakt, zu Abbruchkriterien, zum Angebot paralleler Beratungs- bzw. Vermittlungs- und Auswertungsgespräche, zum Hinweis auf den Erprobungscharakter der Maßnahme etc.
b) Klare Absprachen und Festlegung von Spielregeln für die Durchführung. Neben den Vorgaben und Absprachen der äußeren Rahmenbedingungen besteht auch die Notwendigkeit, Spielregeln für die Durchführung des begleiteten Umgangs festzulegen. Je mehr die beteiligten Familienmitglieder sie nachvollziehen und akzeptieren können, umso wahrscheinlicher wird deren Einhaltung. Ein Übermaß an Spielregeln provoziert Übertretungen, zu wenige Spielregeln verunsichern. Bei den meisten Spielregeln geht es um Selbstverständlichkeiten, die den Eltern gegenüber nicht „durchgesetzt“ werden müssen. Spielregeln haben aber nur dann einen Sinn, wenn es auch Konsequenzen für deren Nichteinhaltung gibt. Im Idealfall werden Spielregeln gemeinsam mit den Eltern erarbeitet und festgelegt. Der Umgangsbegleiter kann sie aber auch einseitig fixieren.
Solche Spielregeln umfassen zum Beispiel das Verbot bzw. die Zurückhaltung von Vorwürfen dem Kind gegenüber, von Abwertungen und Kritik dem anderen Elternteil gegenüber, von Ausfragen, von Vermittlungsaufträgen an das Kind, von bedrängenden Äußerungen zu mehr Kontakt. Sie umfassen auch Absprachen zum Mitbringen von Geschenken oder Nahrungsmitteln, zum Fotografieren oder Filmen, zum Gebrauch der (deutschen) Sprache zwischen Kind und Vater, zur Rolle des Umgangsbegleiters als eher aktivem, mitbeteiligtem Kontaktförderer von Vater und Kind oder zurückhaltendem Hintergrundbegleiter.
Grundsätzlich gilt ganz allgemein folgende Spielregel für Väter: Nutze die Zeit des Zusammenseins so, dass sie für dein Kind (und auch für dich) angenehm und entspannt ist und dem Kind Lust auf weitere Kontakte macht!
c) „Innere“ Vorbereitung von Vater und Mutter. Bei der Vorbereitung auf einen begleiteten Umgang geht es nicht nur darum, Rahmenbedingungen und Spielregeln festzulegen, sondern die beteiligten Familienmitglieder auch auf die oft sehr verunsichernde Situation des begleiteten Umgangs einzustimmen und dabei möglichst viel Verständnis für ihre Befürchtungen, Sorgen, Ängste oder Widerstände, aber auch Wünsche und Bedürfnisse, aufzubringen. Zudem sollten die Eltern auch für die psychische Situation ihrer Kinder im Zusammenhang mit dem begleiteten Umgang sensibilisiert werden (z.B. Informationen zum Bindungsverhalten oder zur Entwicklungspsychologie). Darüber hinaus brauchen (ungeübte) Väter manchmal „Entwicklungshilfe“ und Unterstützung für den konkreten (Spiel-)Kontakt mit ihren Kindern. Der Vorschlag zum Besuch eines Spielwarengeschäfts zur Orientierung über altersgemäßes Spielzeug kann für Väter hilfreich sein. Eltern brauchen auch Anerkennung dafür, dass sie bereit sind, die sehr ungewöhnlichen und meist unnatürlichen Bedingungen eines begleiteten Umgangs zu akzeptieren, und dabei zum Beispiel eigene Befürchtungen zurückzustellen oder Einschränkungen der Intimsphäre hinzunehmen.
d) Vorbereitung und Vertrauensaufbau zum Kind. Eine zentrale Aufgabe in der Vorbereitung auf einen begleiteten Umgang ist der Vertrauensaufbau zum Kind, vor allem bei vorausgehender häuslicher Gewalt. Zunächst sollte der Umgangsbegleiter das Kind mit der Örtlichkeit und mit seiner Person bekannt machen. Entlastend für Kinder ist meistens die Zusicherung, dass es niemals zu einem Kontakt mit dem Vater gezwungen wird. Gleichzeitig wird aber für ein Ausprobieren geworben. Das Kind sollte auch die Möglichkeit haben, durch besondere Signale (die nur dem Umgangsbegleiter bekannt sind) einen Termin abbrechen zu können, wenn er zu belastend wird.
Sehr wichtig ist es auch, das Kind vor Beginn der Maßnahme über dessen Hintergründe, Sinn und Funktion zu informieren, zum Beispiel in folgender Form:
„Weil dein Papa dich unbedingt sehen will, die Mama aber meint, dass dir das nicht gut tut und sich deine Eltern sich deswegen nicht einigen konnten, hat der Richter einem jeden von ihnen ein bisschen Recht gegeben: Der Papa darf dich treffen, aber nur, wenn ich mit dabei bin. So braucht die Mama keine Angst zu haben, dass es dir beim Papa nicht gut geht und der Papa kann sich freuen, wenn er mit dir zusammentrifft.“
Eine Befragung ergab, dass die Hälfte aller betroffenen Kinder nicht erklären konnte, warum sie an einem begleiteten Umgang teilnehmen.
Solche Erklärungen sollen einer unnötigen (Vor-)Verurteilung des Vaters entgegenwirken, um beim Kind nicht unnötige Ängste zu schüren. Sinnvoll ist es auch, das Kind an der Ausgestaltung von Spielregeln zu beteiligen. Es soll darüber hinaus auch über die zeitlichen Rahmenbedingungen informiert werden. Selbstverständlich werden ihm auch so genannte Zwischendurchtermine angeboten, bei denen man gemeinsame Erfahrungen beim begleiteten Umgang auswertet und Änderungsmöglichkeiten bespricht. Ganz wesentlich ist dabei die Zusicherung von absoluter Vertraulichkeit und Verschwiegenheit über die Äußerungen des Kindes seinen Eltern gegenüber, wenn das Kind es wünscht.
Der „ideale“ Umgangsbegleiter bewegt sich zwischen sicherheitsgebendem Bodyguard, Vertrauensperson, Entwicklungshelfer, Vermittler und Fachautorität. Er schützt das Kind und erkennt die berechtigten Interessen und Bedürfnisse der Eltern und Kinder an. Er ist in seinem Vorgehen sehr transparent, gibt Auskunft über seine Absichten, Einschätzungen und Überlegungen, ohne sich unnötig zu rechtfertigen, ist somit Garant von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit.
V. Begleiteter Umgang im Kontext familiärer Gewalt
1. Formen, Vorkommen und Ausprägung familiärer Gewalt4
Für die Praktiker des begleiteten Umgangs stellt sich sehr häufig die Frage, ob die von Kindern selbst erfahrene bzw. beobachtete familiäre Gewalt ein Ausschlusskriterium für die Durchführung eines begleiteten Umgangs ist, oder ob unter bestimmten Voraussetzungen ein mit dem Kindeswohl verträglicher begleiteter Umgang durchgeführt werden kann.
Den Diskussionen dazu liegen häufig sehr unterschiedliche Gewaltbegriffe zu Grunde.
Eine sehr weitgefasste Definition versteht häusliche Gewalt als jede Art körperlicher, seelischer oder sexueller Misshandlung zwischen Erwachsenen bzw. Kindern gegenüber, die dazu führt, den anderen zu verletzen, einzuschüchtern, zu schaden, zu kontrollieren und zu beherrschen, so dass er in Angst und Abhängigkeit lebt. Unterschieden wird dabei zwischen körperlicher Gewalt im Sinne von Misshandlungen, die von einer „einfachen“ Ohrfeige bis hin zu Mord oder Todschlag gehen können (Stoßen, Treten, Schlagen, An-den-Haaren-Ziehen etc.) und psychischer Gewalt.
Zur psychischen Gewalt zählen Drohungen (z.B. Kindesentführung, erweiterter Suizid) und Nötigungen, Belästigungen, Verfolgungen und Terror, systematische Beschimpfungen und Abwertungen, ökonomische Gewalt, Isolation und Kontrolle.
Sexuelle Gewalt umfasst Missbrauchshandlungen, zum Beispiel Vergewaltigungen oder den entwürdigenden und erniedrigenden Zwang zu sexuellen Handlungen.
Gelegentlich wird in der Literatur auch unterschieden zwischen einmaliger Gewalthandlung, wiederholter gewalttätiger Konfliktaustragung, erheblicher Gewalt mit langjähriger Vorgeschichte, extremer Gewalt mit Körperverletzung und ständiger Gewaltbereitschaft ohne jegliches Unrechtsbewusstsein des Täters.
Neuere Studien belegen die überraschend hohen Gewalthandlungen von Frauen gegenüber Männern. Eine Studie des Ministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugendliche ergab bei einer Befragung von 400 Männern, dass jeder vierte Mann ein- oder mehrmals einen Akt der körperlichen Gewalt durch die aktuelle oder letzte Partnerin erfahren hat. Die Verletzungshäufigkeit bei Frauen ist wesentlich höher und somit auch die Schwere der Gewalt. Zur Frage, ob mehr Frauen oder Männer ihre Kinder misshandeln, liegen unterschiedliche Zahlen vor, mit Tendenz zu einem leicht erhöhten Anteil der Gewalt durch Mütter.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den „klassischen“ und häufigeren Fall, bei dem Männer gegen Frauen vor allem physisch, aber auch massiv psychisch gewalttätig wurden. Bei häuslicher Gewalt sind auch 80% bis 90% Kinder Zeugen oder selbst betroffene Opfer.
2. Familiäre Gewalt - ein Ausschlusskriterium für den begleiteten Umgang?5
Hat ein Vater sein pädagogisches und moralisches Recht verwirkt, der sein Kind geschlagen hat bzw. ihm das Beobachten von Gewalt an der Mutter zugemutet hat? Ist der Kontakt zu einem solch gewalttätigen Vater einem Kind bzw. dem Kindeswohl zumutbar? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Welches modifizierte Verfahrensdesign des begleiteten Umgangs ist dafür notwendig und angemessen?
Neben der im Vordergrund stehenden Entscheidung über die Zumutbarkeit eines begleiteten Umgangs für das Kindeswohl steht auch die persönliche Gewissensfrage eines Umgangsbegleiters: Will und kann ich mit einem Gewalttäter zusammenarbeiten, der bei mir selbst Angst, Abwehr und Widerstand auslöst? Deswegen sollte in der Vorbereitung auf einen begleiteten Umgang der Umgangsbegleiter seine eigene Beziehung zu den Beteiligten ehrlich reflektieren und zum Beispiel seine Retter- bzw. Bestrafungsimpulse im Blick haben. Hat der Vater eine echte Chance, und die innere Unterstützung für seine Kontaktaufnahme mit dem Kind durch den Umgangsbegleiter?
Kinder, die mehrfach Opfer familiärer Gewalt wurden, stellen einen besonders belasteten und verwundbaren Teil ihrer Altersgruppe dar.
Es gibt mehrere Gründe, die Umgangskontakte nach häuslicher Gewalt sehr in Frage stellen:
-
Das Risiko von fortgesetzter Partnerschaftsgewalt auch nach der Trennung. Der begleitete Umgang kann zwar zu mehr Verständigung zwischen den Eltern beitragen, aber auch den Elternkonflikt neu aktualisieren.
-
Gewalttätige Elternteile sind häufig auch in ihrer Erziehungsfähigkeit eingeschränkt. Oft geht die Ausübung von Partnerschaftsgewalt auch einher mit Kindesmisshandlung. Gerade bei sehr schwerer Partnerschaftsgewalt liegt die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kinder misshandelt werden, bei nahezu 100%. Mit Gewaltausübung einher geht häufig ein überaus autoritärer Erziehungsstil, verbunden mit einer hohen Selbstbezogenheit, Irritierbarkeit und geringer Frustrationstoleranz des Täters.
-
Wenn ein Kind die Gewalt des Vaters gegenüber der Mutter erleben muss, stört das nicht nur die emotionale Sicherheit und Beziehung zum gewaltausübenden Elternteil, sondern auch zur Mutter. Hier kann es sinnvoll sein, dem Aufbau einer Vertrauensbeziehung zur Mutter Vorrang vor der Durchführung eines begleiteten Umgangs zu geben. Umgangskontakte nach Partnerschaftsgewalt sind häufig verbunden mit großen emotionalen Belastungen der ohnehin schon vulnerablen Kinder, auch wenn sich ein erheblicher Teil der Kinder davon den Kontakt zum Vater wünscht.
Der weit häufigere Fall ist der der Umgangsverweigerung eines Kindes nach familiärer Gewalt. Zu hinterfragen ist allerdings, ob ein entsprechend geäußerter Wille des Kindes wirklich auch seinem Wohl entspricht. Kann ein (v.a. kleineres) Kind wirklich selbst wissen und entscheiden, was gut für es ist? Deswegen sollte eine Umgangsverweigerung nicht grundsätzlich zu einem Ausschluss eines begleiteten Umgangs führen, sondern es sollte in begründeten Fällen zumindest ein Versuch dazu erwogen werden.
Vor der Durchführung eines begleiteten Umgangs gilt es hauptsächlich folgende Fragen zu klären:
-
Ist ein Kind durch die vorausgehende (miterlebte oder selbst erlittene) Gewalt so traumatisiert, dass ein Zusammentreffen mit dem Täter zu weiter schädigenden Re-Traumatisierungen führen kann? Hier könnte eine vorausgehende Traumatherapie des Kindes und einer Tätertherapie des Vaters Bedingung für den späteren Versuch eines begleiteten Umgangs sein.
-
Besteht durch das Zusammentreffen von Vater und Kind die Chance, Vertrauen und Sicherheit zwischen beiden wiederherzustellen, so dass ein Versuch dazu gerechtfertigt erscheint?
-
Wie weit ist der Vater einsichtig und hat Verständnis dafür, welche Belastungen durch die familiäre Gewalt für das Kind entstanden sind? Ist er auch bereit, entsprechende Sicherheitsplanungen zu akzeptieren?
-
Wie weit ist im Rahmen des begleiteten Umgangs die Sicherheit der Opfer gewährleistet bzw. kann fortgesetzte Gewalt weitgehend ausgeschlossen werden?
3. Gewalt-Screening vor dem begleiteten Umgang6
In Kanada und einigen skandinavischen Ländern ist es vor Beginn einer Mediation Pflicht, die beteiligten Eltern explizit nach ihren Gewalterfahrungen - selbstverständlich in getrennten Gesprächen - zu befragen. Vielfach werden Gewalterfahrungen aus Angst oder Scham nicht berichtet, so dass standardisierte Interviews dabei helfen sollen, Gewalterfahrungen zu thematisieren. Erst im Anschluss daran wird entschieden, ob eine Mediation sinnvoll und gerechtfertigt ist. Zu Beginn einer Mediation im Kontext von Partnergewalt steht die „Sicherheitsplanung“ für die Opfer.
Ein solches Vorgehen bietet sich auch für den begleiteten Umgang an, bei dem mögliche Opfer vor Gewalt geschützt werden sollen. Erst nach Abschluss und Akzeptanz dieser „Sicherheitsplanung“ durch den (erwiesenen oder vermuteten) Täter, kann ein begleiteter Umgang erprobt bzw. durchgeführt werden.
Bei der Frage nach familiärer Gewalt wird der Umgangsbegleiter sehr häufig mit sehr unterschiedlichen bzw. widersprüchlichen Darstellungen konfrontiert. Dabei gerät er selbst schnell in einen Rollenkonflikt zwischen Wahrheitsermittler und allparteilicher Vertrauensperson, der einerseits Opfer und Täter identifizieren und andererseits verständnisvolle Vertrauensperson sein will.
Sehr häufig kommt es bei einem Gewalt-Screening vor, dass der Täter die Tat leugnet („Ich habe sie nicht geschlagen - sie ist gestürzt“), bagatellisiert („Ich habe sie nicht fest angefasst - sie bekommt nur so leicht blaue Flecke“) oder verfälscht („Ich habe sie zwar fest angepackt, aber ich hatte keine andere Wahl: Sie wäre sonst bei Nacht und Nebel aus dem Haus gerannt“). In einigen Fällen kommt es auch zu einer totalen Abspaltung der Gewalthandlung. Auch wenn der Täter grundsätzlich seine Tat nicht leugnet, so versucht er doch häufig, sie zum Beispiel durch häusliche oder berufliche Umstände zu rechtfertigen, oder als einmaligen „Aussetzer“ herunterzuspielen bzw. seine Partnerin als Mittäterin zu belasten („Sie hat mich betrogen. Sie hat mich provoziert.“). Extreme Gewalt des Vaters gegenüber Mutter und/oder Kind ohne Unrechtsbewusstsein schließt einen begleiteten Umgang aus.
Grundsätzlich ist es mehr als wünschenswert, dass der Vater sich vor Beginn eines begleiteten Umgangs vor dem Kind zur Tat bekennt, verbunden mit einem tiefen und glaubwürdigen Bedauern, und verbunden mit glaubwürdigen Angaben dazu, wie er beabsichtigt, eine Wiederholung der Tat zu verhindern. Ist der Vater „geständig“, so kann dieses Bekennen, Bedauern und seine Kontrollbemühungen Vorbedingung der Maßnahme sein.
Damit ein Gewalt-Screening nicht in einem eskalierenden Wechselspiel von „Darstellung“ und „Gegendarstellung“ stecken bleibt, könnte der Umgangsbegleiter sinngemäß folgende Haltung einnehmen:
„Ich habe von jedem von Ihnen zwei (total) unterschiedliche Versionen zum Vorfall gehört. Möglicherweise ist jeder von Ihnen von seiner Schilderung überzeugt und hält sie selbst für wahr. Möglicherweise beschönigt bzw. dramatisiert einer oder Sie beide mehr oder weniger bewusst diese Schilderung, um mich auf seine Seite zu „ziehen“. Ich bin nicht Richter und will auch nicht zu sehr Ermittler sein, der den Wahrheitsgehalt Ihrer Schilderung überprüfen oder feststellen muss. Ich kenne Sie beide viel zu wenig und habe deswegen keinen Grund, dem einen mehr oder weniger oder gar nicht zu glauben. Vielleicht stimmt die Geschichte des einen, vielleicht die des anderen, vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo dazwischen. Ich möchte deswegen im Augenblick von der Gewalttätigkeit im Konjunktiv sprechen, mit dem Risiko, dass Sie als Mutter sich dabei von mir nicht ernst genommen und verstanden fühlen. Trotzdem hoffe ich, dass Sie mein Vorgehen respektieren können.
Selbstverständlich ist Gewalt für mich absolut inakzeptabel, vor allem wenn es um Gewalt des körperlich und psychisch Stärkeren gegenüber dem Schwächeren geht. Für eine solche Gewalt muss der ‚Täter‘ zur Rechenschaft gezogen und vor allem das Opfer geschützt werden. Auch wenn Gewalt inakzeptabel ist, kann es sinnvoll sein, sich zu überlegen, warum es zu dieser Gewalt gekommen ist, um sie künftig besser kontrollieren zu können.
Kurzum: Für mich besteht die Situation, dass Aussage gegen Aussage steht. Für mich ist in einer solchen Situation aber klar, dass im Zweifelsfall der Schutz des (vermeintlichen) Opfers wichtiger ist, als der ‚gute Ruf‘ des (vermeintlichen) Täters. Deswegen möchte ich zu Beginn der Vorbereitung auf den begleiteten Umgang eine so genannte ‚Sicherheitsplanung‘ machen.“
4. Sicherheitsplanung vor Beginn des begleiteten Umgangs
Die Sicherheitsplanung für das/die Opfer kann folgende Maßnahmen umfassen:
-
klare Haltung des Umgangsbegleiters zur Gewalt,
-
räumliche Trennung der Eltern auch innerhalb der Wohnung,
-
keine spontanen Anrufe zwischen den Eltern: Kontaktverbot,
-
Beziehungs- bzw. Konfliktthemen werden nicht ohne Dritte besprochen,
-
Hinweis auf Selbsthilfegruppen bzw. Selbstverteidigungsmaßnahmen für das Opfer,
-
Teilnahme des Täters an einem Aggressionsbewältigungsprogramm,
-
Hinweise und Informationen an das Opfer über seine rechtlichen Schutzmöglichkeiten (Opferschutzgesetz),
-
Unterstützungssysteme für das Opfer außerhalb des begleiteten Umgangs organisieren,
-
getrenntes bzw. zeitversetztes Kommen und Gehen zum begleiteten Umgang,
-
Redeverbot bei der Übergabe der Kinder, außer einer Begrüßung und Verabschiedung,
-
Übergabe der Kinder an einem neutralen Ort,
-
Übergabe und Abholung der Kinder durch dritte Personen,
-
Unterstützungsperson (Bodyguard) für das Herbringen und Abholen organisieren,
-
alle wichtigen Infos zum begleiteten Umgang werden über den Umgangsbegleiter an den anderen Partner vermittelt,
-
Pendelmediation zur Vereinbarung weiterer Umgangskontakte,
-
unterschiedliche Warteräume für Eltern,
-
gemeinsame Gespräche sind absolut freiwillig und nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Opfers möglich,
-
räumliche Sitzordnung bei Gesprächen nach Wunsch des Opfers,
-
gemischtes Beraterpaar bei parallelen, flankierenden Gesprächen zum begleiteten Umgang,
-
Angebot zu Einzelgesprächen,
-
alle Vereinbarungen bezüglich der Kinder müssen auch die Sicherheit des Opfers gewährleisten.
Die Frage, ob ein begleiteter Umgang auf dem Hintergrund familiärer Gewalt grundsätzlich sinnvoll, vertretbar oder möglich ist, lässt sich oft schwerer beantworten als die Frage, unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen zumindest eine Erprobungsphase des begleiteten Kontakts zwischen Vater und Kind gerechtfertigt ist. Bei der Entscheidung dazu sollte den Schutzbedürfnissen der Opfer ebenso Rechnung getragen werden, wie geklärt werden muss, ob die möglichen emotionalen Kosten und Belastungen für das Kind den möglichen Nutzen einer Vater-Kind-Beziehung rechtfertigen.
*Der Autor ist Leiter der „Familienberatung bei Trennung und Scheidung“ am AG Regensburg.
1Ausführliche Beschreibung des Regensburger Modells in: Vergho, KindPrax 2001, 71.
2Detaillierte Darstellung der Skalen in: Friedrich, Qualität beobachteter Eltern-Kind-Interaktion während begleiteter Umgangskontakte, 2004.
3Ausführliche und detaillierte Check-Liste mit Beispielen in: Vergho, Die Vorbereitung auf einen begleiteten Umgang - wie können gute Arbeitsbeziehungen zwischen den Beteiligten hergestellt werden, in: Klinkhammer/Klotmann/Prinz, Hdb. Begleiteter Umgang, 2004, S. 139 bis 158.
4S. auch vergleichende Zahlen in: Wyss, Wenn Frauen gewalttätig werden, Fakten kontra Mythen - 4. Gewaltbericht der kantonalen Fachkommission für Gleichstellungsfragen, 2005.
5Ein sehr guter Überblick zu aktuellen Stand der Forschung in: Friedrich/Reinhold/Kindler, (Begleiteter) Umgang und Kindeswohl, in: Klinkhammer/Klotmann/Prinz (o. Fußn. 3), S. 13 bis 40.
6Vergleichende Überlegungen zur Verfahrensgestaltung bei Mediation und Beziehungsgewalt s. auch in: Gläßer, ZKM (Zeitschrift für Konfliktmanagement) 2000, 206.
|
|
| nach oben |
|
 |
|
powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos
Design © trevorj
|
